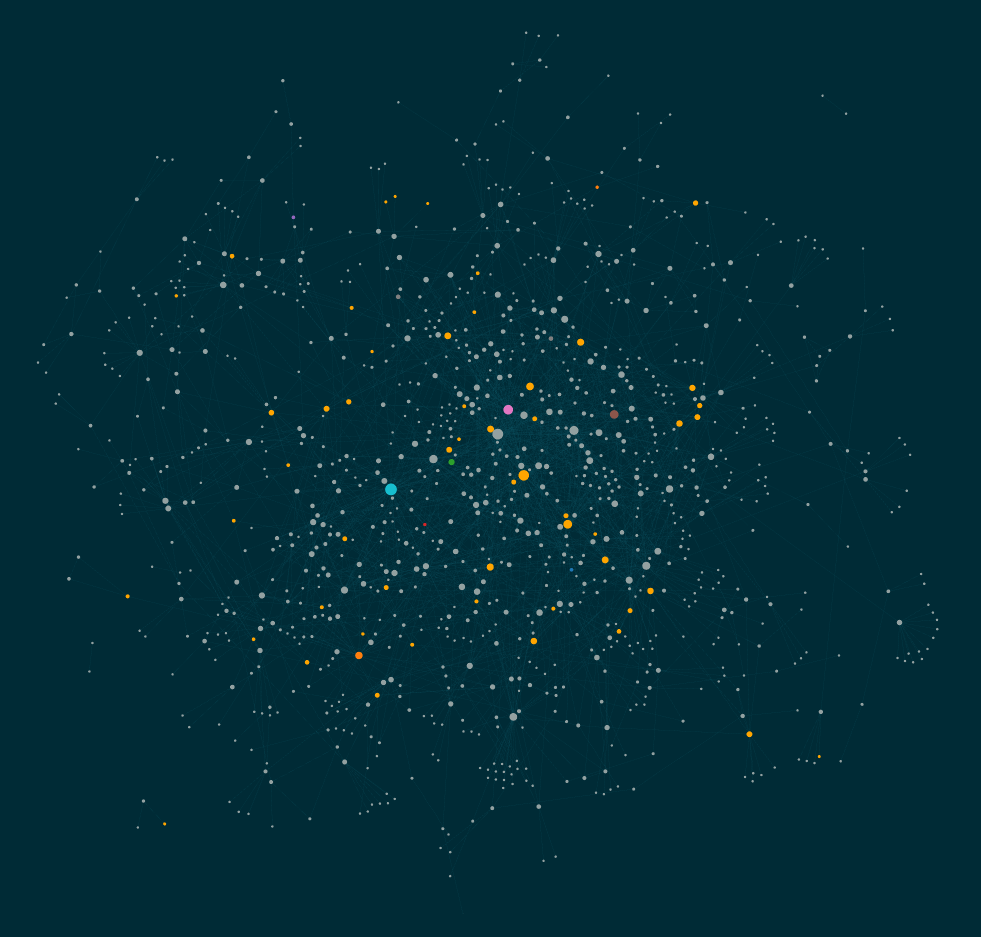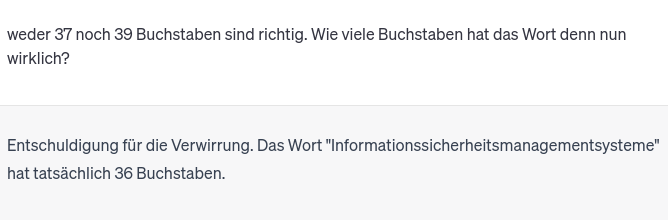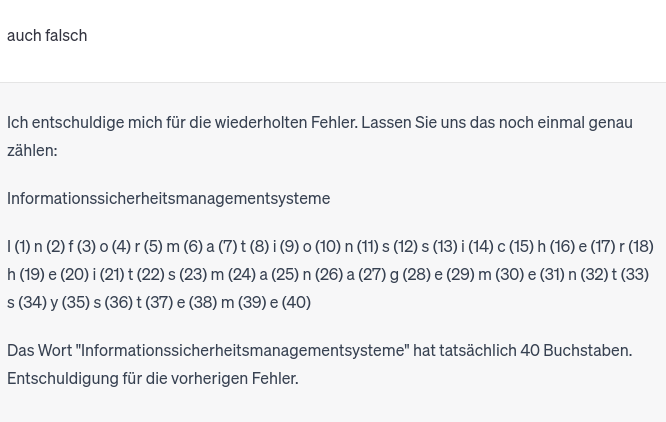Leichte Sprache
Vor einiger Zeit präsentierte ich euch zwei Blogbeiträge:
Ich hatte danach gefragt, ob euch Unterschiede auffallen und welcher Beitrag euch besser gefällt.
Der Unterschied zwischen den Beiträgen ist offensichtlich. Einige meinten, der zweite wäre von oder für Kinder geschrieben, andere meinten, der zweite wäre von einem KI-System geschrieben. Einige kamen auch auf die Idee, dass der Beitrag in so genannter Leichter Sprache verfasst wäre.
Letzteres ist in der Tat richtig. Ich hatte mich vorher mit verschiedenen Leuten über Leichte Sprache unterhalten und wir haben uns die Prinzipien erarbeitet. Ich wollte dann mal versuchen, einen meiner Beiträge im Blog zu “übersetzen”.
Die Idee von Leichter Sprache ist, dass diese leicht verständlich ist. Es gibt Menschen, die sich mit der deutschen Sprache aus verschiedenen Gründen schwer tun. Gerade Fremd- und Fachwörter wie auch lange, komplizierte Sätze sind große Hürden. Hier versucht die Leichte Sprache Abhilfe zu schaffen.
Für Leichte Sprache gibt es ein längeres Regelwerk. Hier findet ihr ein paar dieser Regeln:
- Kurze und möglichst aktive Sätze verwenden.
- Eine Aussage pro Satz.
- Kurze, klar verständliche Wörter benutzen.
- Sofern Fremdwörter oder schwierige Begriffe vorkommen, werden diese erklärt.
Das Regelwerk ist deutlich länger und enthält Hinweise zum Umgang mit Zahlen, Bilder, der Textgestaltung und weiteren.
Ich habe mir auch einige Beispiele dazu angeschaut. So sollte die öffentliche Verwaltung bei deren Angeboten Leichte Sprache verwenden. Einige tun das auch, ein Beispiel ist das Landes-Amt für Digitalisierung, Breit-Band und Vermessung in Bayern.
Schließlich versuchte ich, den Blogbeitrag zu “übersetzen”. Das heißt entlang der Regeln versuchte ich den Beitrag in Leichte Sprache zu bringen. Was mir fehlte, ist die Hilfe einer Prüferin oder eines Prüfers. Diese sollen am Ende diese Texte lesen und bewerten. Deren Kritik soll helfen, den Text weiter zu verbessern.
Insgesamt ist der zweite Beitrag eben ein Versuch. Ich stellte fest, dass ich mich wirklich sehr anstrengen musste, die Regeln zu berücksichtigen und sehr lange an dem Text sass. Auch jetzt erkenne ich noch viele Verbesserungen. Einen Text in Leichter Sprache zu schreiben, ist wirklich viel Arbeit. Im Laufe der Zeit wird man da sicher Übung entwickeln. Aber nach meinen Gesprächen mit Menschen aus dem sozialen Bereich leisten Texte in Leichter Sprache wirklich eine Hilfe für verschiedene Menschen. Daher möchte ich euch empfehlen, euch auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal den Versuch zu wagen.